Physiologie,
Mathematik, Musik und Medizin:
Definitionen und Konzepte für die Forschung
1. Teil
von
Ralph Spintge
Einführung
und
Begriffserklärung
In den vergangenen 15 Jahren sind bedeutende Fortschritte
sowohl in der Forschung als auch in der klinischen
Anwendung von Musik in der Medizin erzielt worden.
Heute schließlich liegen zuverlässige
Beweise dafür vor, daß Musik eine reproduzierbare
Wirkung ausübt und über wertvolle therapeutische
Eigenschaften verfügt. Aus diesem Grund schlagen
wir als Begriff für den therapeutischen Einsatz
von Musik in der Medizin die Bezeichnung MusikMedizin
(ein Wort, zwei große M) vor.
Ebenso
umfassend wie wesensbezogen steht das Wort
"MusikMedizin" für eine wissenschaftliche
Bewertung musikalischer Stimuli im medizinischen
Bezugsrahmen, insbesondere über mathematische,
physikalische, physiologische und medizinische
Untersuchungen - aber auch im Hinblick auf
ihre therapeutische Anwendung zur Ergänzung
traditioneller Heilmethoden unter Beachtung
des jeweiligen Krankheitsfalles, der zugehörigen
Medikation sowie des individuellen Procedere
(s. auch Spintge & Droh 1992a; Maranto
1992; Pratt 1995).
Dieser
Ansatz unterscheidet sich von dem der Musiktherapie
als Teil der psychiatrischen Fürsorge
oder der Psychotherapie (Aldridge 1993).
Wir verstehen Musiktherapie als psychotherapeutische
Anwendung der Musik, als eigenständige
Spezialität. Natürlich besteht
grundsätzlich ein verwandtschaftliches
Verhältnis zwischen MusikMedizin und
Musiktherapie. Hinzu kommt, daß der
Begriff "Musikmedizin" heute
auch mit Berufskrankheiten von Musikern
und Tänzern assoziiert wird.
Die
Hauptfrage in diesem Zusammenhang bleibt
jedoch noch immer unbeantwortet: Warum ist
Musik wirksam und welche sind ihre Wirkungsparameter?
Es scheint allgemeiner Konsens darüber
zu bestehen, daß Musik möglicherweise
das wirksamste emotionale und ästhetische
Kommunikationsmittel überhaupt ist.
Es gab und gibt keine menschliche Zivilisation,
in der nicht Musik gemacht und erlebt wurde.
Die Frage bleibt: wie können wir den
musikalischen Code für emotionale Kommunikation
entschlüsseln? Unsere klinische Arbeit
führt uns zu der Annahme, daß
der Rhythmus das effektivste musikalische
Element darstellen könnte. Der musikalische
Rhythmus wird als strukturierte Abfolge
von metrischen, melodischen und harmonischen
Einheiten über die Zeit innerhalb eines
Musikstückes verstanden. Von einem
eher biologisch orientierten Blickwinkel
aus betrachtet, ist er eine strukturierte
Abfolge von zeitbezogenen Funktionseinheiten
innerhalb eines dynamischen Systems.
Die
wesentliche Rolle des Rhythmus wird beispielsweise durch
unsere Erkenntnisse über die Wurzeln der Musik
und der Heilkunde bestätigt. Die menschliche Kulturgeschichte
war schon immer auch eine Geschichte der Religion, der
Heilkünste und genauso die Geschichte der Musik.
Musik war schon in der Steinzeit, vor rund 12.000 Jahren,
Bestandteil des menschlichen Lebens (Soffer 1985). Bereits
aus den ältesten erhaltenen schriftlichen Belegen
für die Existenz der Heilkünste geht die Anwendung
von Musik als Teil eines mystischen, religiösen
Heilungszeremoniells hervor (Codex Hammurabi, ca. 4.000
v. Chr., s. auch Übersicht bei Spintge 1992a).
Später
wurde die Musik selbst zum Heilmittel (Kuemmel 1977).
Wenn wir uns mit dem spezifischen Wert beschäftigen,
den die Musik offenbar für den Menschen der Frühzeit
besaß, sollten wir uns des Umstandes bewußt
werden, daß die Wahrnehmung der Zeit als Grundbestandteil
unserer Existenz in rhythmischen Zyklen organisiert
ist, wie etwa Tag und Nacht, die Aufeinanderfolge der
vier Jahreszeiten, der Menstruationszyklus etc. Seit
Anbeginn der menschlichen Existenz hatte die Organisation
der Zeit selbstverständlich immer einen ganz besonderen,
überlebenswichtigen Stellenwert. Heutzutage stellt
die Lehre von den Biorhythmen einen neuen, aber bereits
fest etablierten Wissenschaftszweig dar. Diese beherrschen
das Verhalten biologischer Systeme von der molekularen
Ebene bis hin zu makroskopischen Verhaltensmustern ganzer
Gruppen von Individuen.
Ist
Rhythmizität das fehlende Bindeglied
zwischen Musik, Physiologie und Medizin?
Dieses
Thema ist Gegenstand unserer derzeitigen Untersuchungen.
Rhythmizität wird als strukturierte Koordination
zweier unterschiedlicher Rhythmen über die Zeit in
einem dynamischen System verstanden, einschließlich
interaktiver Phänomene wie Synchronisation, Extinktion,
Verstärkung und Kopplung (Abel, Geier, Spintge u.
Droh 1996; Lex, Pratt, Abel u. Spintge 1996). Das Basiskonzept,
auf dessen Grundlage wir unsere physiologischen Studien
durchführen, ist die folgende Definition der MusikPhysiologie:
Die
MusikPhysiologie als Naturwissenschaft untersucht die
biologischen Eigenschaften der ars musica, die wiederum
menschliche Emotionen und Gefühle durch eine harmonische
und rhythmisch strukturierte Abfolge von akustischen
Stimuli zum Ausdruck bringt. Alle musikalischen Parameter
zeigen einen gewissen Grad einer Zeitordnung oder Zeitstruktur
im Ablauf des musikalischen Prozesses. Daher sucht die
MusikPhysiologie nach biologischen Zeitstrukturen beim
Menschen, die eine äquivalente "Resonanzadress"
für musikalische Zeitstrukturen darstellen könnten.
Abbildung
1 veranschaulicht mein sogenanntes "missing-link-Konzept"
der zwischen Physiologie, Medizin, Mathematik / Physik
und Musik bestehenden wechselseitigen Beziehungen, mit
der Rhythmizität als zugrundeliegendes verbindendes
Prinzip. Präzise ausgedrückt, gilt diese Betrachtung
derzeit nur für anxioalgolytische (angst- und schmerzlindernde)
Musik (AAM).
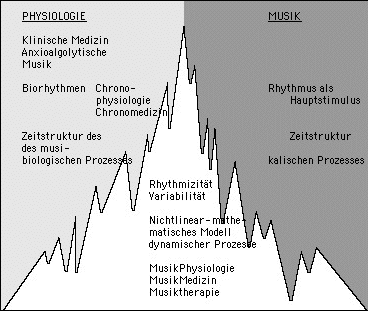
ABB. 1:
Das "missing-link-Konzept": Grundlage der
MusikPhysiologie, MusikMedizin und Musiktherapie - die
Wechselbeziehungen zwischen Physiologie, Medizin, Mathematik
und Musik mit der Rhythmizität als mögliches
Bindeglied ("missing link").
Musik,
Physiologie und Mathematik
Rhythmen
stellen eins der beherrschenden Grundphänomene
- vielleicht sogar das vorherrschende Phänomen
- in allen biologischen Systemen dar (Haken & Koepchen
1991). Erst kürzlich haben Untersuchungen zur Rhythmizität
in Physiologie, Medizin und Mathematik ein breites Interesse
geweckt. Während musikalische Rhythmen per se interessant
für Musikologen, Musiker, Musikpsychologen und
Musiktherapeuten sind, hat sich die Rhythmusforschung
rasend schnell in physikalischen, physiologischen und
mathematischen Untersuchungsansätzen sowie in der
klinischen Medizin ausgebreitet.Dieser
Trend wird durch neue Methoden der Datenerhebung und
-analyse noch gefördert.
Nicht-invasive
Methoden zur kontinuierlichen Betrachtung von dynamischen
physiologischen Prozessen in Verbindung mit computergestützten
Bewertungssystemen wie auch neuartige mathematische
Konzepte zur Analyse von nicht-linearen biologischen
Systemen erlauben es, die komplexen Wechselwirkungen
von unterschiedlichen oszillierenden Systemen zu beobachten,
zu beschreiben, zu visualisieren und auch vorherzusagen
(Haken 1978, 1986; Haken & Koepchen 1991).
Ein
solches System könnte beispielsweise die Musik
sein, das andere die Rhythmizität der Herzfrequenz
oder die elektrische Hirnaktivität (EEG). Bemerkenswert
in diesem Zusammenhang ist, daß Gesetzmäßigkeiten
biophysikalischen Verhaltens wie auch die Methoden zur
Beschreibung ihrer Wechselwirkungen in so gänzlich
verschiedenen Bereichen wie Physiologie, Laserphysik,
Ökologie, Wirtschaftslehre, Straßenverkehrsüberwachung,
Wachstumsmuster von Pflanzen, Kardiologie und anderen
mathematisch berechenbar sind (Haken & Koepchen
1991; Haken 1992).
In
der Medizin belegt die Rhythmusforschung bereits eine
große Bandbreite von Phänomenen wie etwa
Herzfrequenz-Variabilität (Ereignisvorhersage nach
Herzinfarkt), Autorhythmizität von Blutgefäßen
(Steuerung von Blutdruck und Durchblutung), rhythmische
Aktivität des sympathischen Nervensystems (Performance-Steigerung
bei Leistungssportlern, Linderung chronischer Schmerzen),
Rhythmogenese von Atmungsvorgängen (Schlaf-Apnoe,
plötzlicher Kindstod), Synchronisation und Koordination
motorischer Funktionen (Leistungssteigerung im Sport),
zirkadiane Schlafrhythmen, elektrische Hirnaktivität,
Oszillation in der Wahrnehmung, chemische Kommunikationsvorgänge
im Zellinneren und zwischen den Zellen, und viele andere
mehr (Abel, Berger, Conze, Droh, Klüssendorf, Koepchen,
Koralewski, Krause, Spintge 1994; Haken, Kelso u. Bunz
1985; Haken & Koepchen 1991).
Auch
wenn einige Forschungsgruppen versucht haben, ein umfassendes
mathematisches Modell für die Musik zu erstellen,
sind wir eher der Ansicht, daß es lohnender ist,
mit nur einem musikalischen Parameter zu beginnen -
dem Rhythmus. Ein kurzer Abriß unseres musikphysiologischen
Konzeptes folgt weiter unten (weitere Einzelheiten siehe
bei Koepchen, Droh, Spintge, Abel, Klüssendorf
u. Koralewski 1993). Biologisches Leben ist ein rhythmisch
organisierter Prozeß mit Frequenzen, die sich
über eine große Bandbreite erstrecken. Sogar
Moleküle, die kleinsten Komponenten der Lebensfunktion,
durchlaufen oszillatorische chemische und funktionale
Wandlungen.
Das
menschliche Leben ist als Teil der lebendigen Welt eingebettet
in rhythmische Ordnungen, auch wenn wir nur einen sehr
begrenzten Teil all dieser Rhythmen bewußt wahrnehmen.
Die meisten makroskopisch beobachtbaren Rhythmen basieren
auf der wechselseitigen Koordination vieler Einzelelemente
in einer ganz charakteristischen Form der Selbstorganisation.
Auf diese so sehr unterschiedlichen Lebenssysteme kann
eine nichtlineare mathematische Analyse der Selbstorganisation
angewandt werden. Da die sich wechselseitig beeinflussenden
physiologischen Rhythmen durch die Synchronisation
und Selbstorganisation aus lauter oszillierenden Untereinheiten
entstehen, ist diese neue Art der Mathematik imstande,
die komplexe biologische Rhythmizität zu quantifizieren
und zu analysieren.
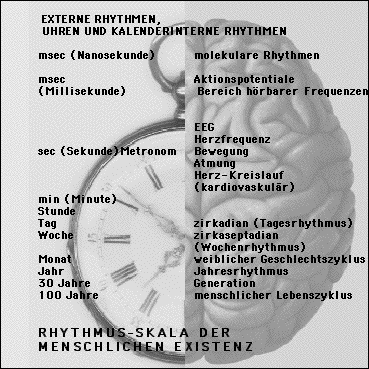
Abb.
2:
Bandbreite der Frequenzen menschlicher physiologischer
Rhythmen auf einer logarithmischen Skala mit den Frequenzen
auf der linken und den Perioden auf der rechten Seite.
Externe Rhythmen, die von der Außenwelt her auf
den Organismus einwirken, werden auf der linken Seite
angezeigt, interne Rhythmen auf der rechten. Die Dreiecke
auf der rechten Seite charakterisieren den Bereich,
in dem die jeweiligen Rhythmen auftreten, und die typische
Frequenz für den betreffenden Rhythmus. Man beachte
die großen Frequenzbreiten mit beträchtlichen
Überlappungen im Bereich der neurovegetativen und
motorischen Rhythmen, verglichen mit den kleinen Variabilitäts-Bandbreiten
der langsameren Rhythmen, die durch Anpassung an externe
Rhythmen entstanden sind.
Bemerkenswert
ist auch, daß der Frequenzbereich, der in einem
Metronom (das in musikalischen Studien benutzt
wird) angelegt ist, exakt mit dem Frequenzbereich des
Herzschlages übereinstimmt, die zwischen Ruheperioden
und körperlicher Arbeit auftreten können.
Im Hinblick auf die physiologische Rhythmizität
weist dieser Bereich einige charakteristische Merkmale
auf: diese Rhythmen erscheinen in Systemen mit homöostatischer
Rückkopplungs-Eigenregulierung vitaler Funktionen
wie etwa der Steuerung des arteriellen Blutdruckes oder
der Blutgaskonzentration. Daraus resultiert, daß
zwischen der homöostatischen Funktion der Stabilität
und dem rhythmischen Wechsel (der Veränderlichkeit)
von vitalen Parametern ein permanenter Wettbewerb stattfindet,
wobei beide Parameter den jeweils anderen begrenzen.
Dies
trifft insbesondere für die Wechselwirkungen zwischen
den vegetativen (autonomen) und den somatomotorischen
Systemen zu. Man darf dabei nicht außer acht lassen,
daß die rhythmische Steuerung vegetativer Prozesse
in einem gemeinsamen Netzwerk von Neuronen im Gehirn
stattfindet, die gleichzeitig für den Wachzustand
des Gehirns wie auch für die Kontrolle des Muskeltonus‘
zuständig sind. Aus diesem Grunde ist dieses neuronale
Netzwerk bei der zentralen Steuerung des emotionalen
Verhaltens, so auch bei der Streßreaktion involviert.
Eine der zuvor angesprochenen Wechselwirkungen, "Einkoppelungseffekt"
bzw. neudeutsch "entrainment" genannt, besteht
darin, daß ein Rhythmus mit einem anderen synchronisiert.
Die qualitative Erfassung der Eigenschaften der Einkoppelung
ist einfach - beispielsweise in der Synchronisation
von motorischer Bewegung und Atmung bei Ruderern oder
Schnelläufern. Eine quantitative Analyse dieser
Wechselbeziehungen dagegen ist sehr viel schwieriger.
Erich
von Holst hat im Jahre 1939 als erster die beiden Prinzipien
nachgewiesen, die die nachfolgenden komplexen physiologisch-rhythmischen
Phänomene steuern: a) den "Magneteffekt"
und b) die "Überlagerung". Der Magneteffekt
ist die Grundlage der Einkoppelung und kann in Form von
statistisch bevorzugten Phasenbeziehungen erklärt
werden, die auch dann auftreten, wenn keine Synchronizität
erreicht wird. Für gewöhnlich führt ein
Rhythmus, und der andere ist von ihm abhängig. Überlagerung
hingegen bedeutet ganz einfach, daß die Amplitude
des einen Rhythmus‘ zu der des anderen hinzugezählt
oder von ihr abgezogen wird, ohne daß dadurch die
Phase beeinflußt wird. Zumeist liegt eine Mischung
von Magneteffekt und Überlagerung vor. Von Holst
prägte den Begriff "relative Koordination",
um diese Regeln in ihrer Gesamtheit zu beschreiben. Sie
sind nicht nur auf die Wechselwirkung unterschiedlicher
interner Rhythmen anwendbar, sondern auch auf die Einwirkung
der Umwelt auf interne Rhythmen. Dies kann man bei der
Koordination von Beinbewegungen bei Rennpferden beobachten
wie auch bei der Saug- und Atemaktivität von Säuglingen
oder menschlichen Handbewegungen (Haken, Kelso u. Bunz
1985).
Die
Rhythmen und oszillatorischen Muster, die das Leben
allgemein auszeichnen, sorgen für die Flexibilität
und kreative Variabilität, die zur Aufrechterhaltung
des Lebens den herausfordernden und lebensbedrohenden
Umweltbedingungen gegenüber vonnöten sind.
Vom medizinischen Standpunkt aus betrachtet, ist es
unbedingt erforderlich, nicht nur darüber Bescheid
zu wissen, wie diese individuellen Rhythmen physiologischer
Funktionen entstehen, sondern auch, wie von außen
einwirkende rhythmische Stimuli - etwa die Musik - die
Modulation der inneren Rhythmen beeinflussen. Aus diesem
Wissen ergibt sich ein gewisser Grad an Vorhersagbarkeit
normaler und abnormaler physiologischer Verhaltensmuster
a) unter den verschiedensten Streßbedingungen,
b) bei chronischen Krankheiten und chronischem Schmerz,
und
c) unter physischer Belastung, mit und ohne Musik, usw.
Weiter
zum 2. Teil
Internationale
Gesellschaft
für Musik in der Medizin (ISMM)
Dr.
Roland Droh
Prof. Dr. Ralph Spintge
Paulmannshöher Straße 17
58515 Lüdenscheid
Die
Internationale Gesellschaft für Musik in der Medizin
(International Society for Music in Medicine, ISMM)
wurde im Jahre 1982 gegründet. Mitglieder
sind Ärzte, Wissenschaftler und Institutionen aus
Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien und Australien.
Alle befassen sich wissenschaftlich, künstlerisch
oder praktisch-klinisch intensiv mit medizinischen Anwendungen
von Musik.
Die
Gesellschaft ISMM bietet die organisatorische Basis
für einen fach- und kulturübergreifenden Austausch
von Konzepten, Erkenntnissen und Erfahrungen zu wissenschaftlichen
Grundlagen und praktisch-klinischen Anwendungen von
Musik in der Medizin. Das Fachorgan des Gesellschaft
ISMM ist das "International Journals of Arts Medicine
IJAM (MBB Music Inc., St. Louis, USA)". Mehrere
Sammelbände zu den Symposien der Gesellschaft haben
sich zu echten Klassikern für alle, die sich für
MusikMedizin interessieren, entwickelt.
Aus Band 1: Hall of Fame:
Prof. Dr. med. Ralph Spintge
ist
einer der Pioniere und Wegbereiter der MusikMedizin.
Über seinen "gewöhnlichen" Tätigkeitsbereich
als Spezialist für Schmerztherapie, Anästhesie
und Arbeitsmedizin hat er derzeit sicherlich einen vollen
Terminkalender: Direktor der Interdisziplinären
Schmerzklinik und des Forschungslabors für MusikMedizin
am Sportkrankenhaus Hellersen in Lüdenscheidt,
beigeordneter Professor am Institut für Musikforschung
San Antonio der University of Texas, als Gründungsmitglied
und geschäftsführender Direktor der International
Society for Music in Medicine (ISMM) und deutscher Verbindungsoffizial
der International ArtsMedicine Association (IAMA).
Autor
von vier Büchern über Musik in der Medizin
und zahlreichen themenbezogenen Fachartikeln, ist Spintge
ferner Mitherausgeber des International Journal of Arts
Medicine (IJAM). Darüberhinaus ist er noch Mitglied
der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie,
der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Psychologie
und Psychopathometrie und Ehrenmitglied der Katalonischen
Gesellschaft für Musiktherapie.
Seine
Approbation als Doktor der Medizin erhielt
Spingte im Jahre 1981 an der medizinischen
Fakultät der Rheinisch-Westfälischen
Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn.
Seine Doktorarbeit befaßt sich mit der
Musik als Therapeutikum bei perioperativen
Angstzuständen. Er kann auf 18 Jahre
Erfahrung in der MusikMedizin-/ Musiktherapieforschung
und 15 Jahre Berufserfahrung in der klinischen
Medizin zurückblicken (Anästhesie,
Intensivstation, Innere Medizin, Schmerztherapie
und arbeitsmedizinische Gesundheitsvorsorge).
Während
mehrerer Auslandsaufenthalte leitete Spintge
in Kooperation mit Naturwissenschaftlern,
Medizinern und Psychologen eine Reihe psychophysiologischer
Studien zu den anxioalgolytischen Wirkungen
von Musik bei operativen Eingriffen, in der
Anästhesie, bei Schmerztherapie, in der
Zahnmedizin und der Geburtshilfe. Dabei arbeitete
er mit Wissenschaftlern der Universität
von Hirosaki, Japan, der Universität
Wien, der Erasmus-Universität Rotterdam,
den Universitäten Marburg, Osnabrück
und Bonn, der Freien Universität Berlin
und dem New South Wales State Conservatorium
of Music in Sydney, Australien.
Seit
1989 arbeitet er im Rahmen eines von der Deutschen Sportilfe
gesponserten Langzeit-Forschungsprogrammes an Untersuchungen
zum neurovegetativen Status im menschlichen Organismus
mit dem Max-Planck-Institut in Dortmund, der Freien
Universität Berlin, der Universität Stuttgart
und dem Bundesforschungszentrum Jülich zusammen.
Seit 1991 leitet er ein Forschungsprogramm zur Wirkung
von Musik bei Schmerzen und Streß, das von der
Deutschen Forschungsgesellschaft für Innovationen
in der Medizin finanziert wird. Von 1987 bis 1991 war
Spintge Dozent für MusikMedizin-/Musiktherapieforschung
in der medizinschen Fakultät der Universität
zu Münster. Er zeichnet mitverantwortlich für
die Organisation von mittlerweile zehn internationalen
Konferenzen, die letzte 1996 zum Thema "MusikMedizin"
am Zentrum für Gesundheitswissenschaften der University
of Texas in San Antonio (USA). Chairboarder von Energon,
Professor für Musiktherapie
in Hamburg
Artikel
von Prof. Ralph Spintge über
"Musik in Anaesthesie und Schmerztherapie
http://home.t-online.de/home/02351945-6/schmerz.htm
Weiter
zum 2. Teil
Energon
CDs bei Amazon bestellen
Interview
mit Prof. Dr. med. Ralph Spintge
|

